
Foto: Antje Vieth
(Berlin, 21. Mai 2024, npla).- Trotz des geplanten Kohleausstiegs der Bundesregierung erreichte im Jahr 2022 und 2023 fast viermal so viel Steinkohle den Hamburger Hafen wie im Vorjahr. Grund dafür waren die Sanktionen gegen Russland und die daraus entstandene Energiekrise für Deutschland. Die wichtigsten deutschen Importländer sind Indonesien, Kolumbien und Südafrika. Besonders Kolumbien rückte aufgrund der prekären Menschenrechtslage rund um den Bergbau in den Fokus der Öffentlichkeit. Nicht umsonst wird sie oft als Blutkohle bezeichnet. Vertreibung, Umleitung der Wasserquellen, Gesundheitliche Auswirkungen für die dort lebenden Menschen sind nur einige Stichwörter. Aber auch in allen anderen Ländern hinterlässt der Bergbau Geisterstädte.
Bergbau und Klimaziele
Im Frühjahr 2023 reiste Wirtschaftsminister Robert Habeck nach Kolumbien; kurz darauf vereinbarte Deutschland mit Kolumbien eine Klima- und Energiepartnerschaft. Im Fokus stehen dabei erneuerbare Energien wie grüner Wasserstoff, was ebenfalls in der Bergbauregion im Norden Kolumbiens für Unternehmen interessant ist. Mit 200 Millionen Euro will die Bundesregierung die Entwicklungszusammenarbeit unterstützen, ganz im Zeichen der Klimaziele. Doch wie sieht die Realität vor Ort aus? Und was ist, wenn Konzernklagen die Versuche, die Menschenrechts- und Umweltlage zu verbessern, massiv behindern?
Aktivistinnen auf Tour in Europa
Im Dezember 2023 reisten drei Aktivistinnen aus der Bergbauregion La Guajira nach Deutschland, um auf die Situation im Norden Kolumbiens aufmerksam zu machen: Greylis Pinto (Sprecherin der durch Cerrejón zwangsumgesiedelten afrokolumbianischen Gemeinde Chancleta), Tatiana Cuenca (Koordinatorin der Umweltorganisation Censat Agua Viva, dem kolumbianischen Zweig von Friends of the Earth) und Carolina Matiz (kolumbianische Menschenrechtsorganisation Cinep). In La Guajira betreibt der Schweizer Konzern Glencore die größte Kohlemine Lateinamerikas. „Diese Tour hat das Ziel, öffentlich anzuprangern, was Glencore in unserem Land macht. Nach außen stellt sich Glencore als verantwortungsbewusst dar, aber wir, die wir in den Gebieten sind, kennen die Probleme der Gemeinden und wissen, dass dies nicht der Fall ist“, erklärt Carolina Matiz.
Kohleabbau hinterlässt Geisterstädte
De facto ist die Region im Norden Kolumbiens in einigen Teilen nicht mehr bewohnbar. Es gibt kein Wasser, kaum Lebensmittel, und die Feinstaubbelastung ist aufgrund des offenen Tagebaus extrem hoch; die Krebsraten sind immens. Über 5000 Kinder starben bereits an den Folgen, viele sind verdurstet. Greylis Pintos Gemeinde Chancleta wurde vor elf Jahren zwangsumgesiedelt. Sie berichtet: „Die aktuelle Situation in La Guajira ist kritisch, Cerrejón Glencore hat immer wieder gegen Gesetze verstoßen, zum Beispiel beim Wasserzugang. Flüsse sind ausgetrocknet, und die Gemeinden sind ohne Trinkwasser. Verletzt wurde auch das Recht auf vorherige Anhörung indigener Gemeinden.“
Tatiana Cuenca von der Umweltorganisation Censat Agua Viva fügt in unserem Gespräch hinzu: „Bisher sind 71 Quellen ausgetrocknet, die direkt an die Gemeinden angeschlossen waren. Das ist auf den Bergbau zurückzuführen. Zurzeit kämpfen wir für den Erhalt des Bruno- Flusses, ein sehr wichtiger Fluss, weil an ihn über 40 Gemeinden angeschlossen sind. Wir kämpfen dagegen, dass Glencore den Fluss umleitet, aber leider wurden hier schon Tatsachen geschaffen, und es wurde bereits ein künstlicher Kanal errichtet, der Schaden ist eigentlich schon entstanden.“
Wenn Konzerne klagen
Glencore hatte 2021 wiederholt Klage gegen den kolumbianischen Staat eingelegt, der versucht hatte, die Erweiterung des Flusses auszusetzen. Eine Entscheidung steht noch aus. In der Vergangenheit sah sich der kolumbianische Staat mit horrenden Zahlungsaufforderungen im Rahmen des sogenannten Investitionsschutzabkommens konfrontiert. Eine Klage hat Glencore bereits gewonnen, Kolumbien musste 19 Millionen Dollar zahlen.
Durch das Investitionsschutzgesetz sind die Unternehmen in der Lage, die Arbeit des Umweltschutzes auszuhebeln: „Wir verteidigen den Kampf um den Bruno-Strom, aber leider übt Glencore Cerrejón auch sehr starken Druck auf internationaler Ebene aus. Vor kurzem hat das Unternehmen Klage im Fall des Bruno-Stroms in diesem internationalen Schiedsgerichtssystem eingereicht, das ein extrem ungleicher Mechanismus der Schiedsgerichtsbarkeit ist“, berichtet Tatiana. Fabian Flues von der Organisation Powershift erklärt, was es mit diesem sehr ungleichen Mechanismus, dem Investitionsschutzgesetz, auf sich hat: „Der Investorenschutz ist eine Art paralleles Rechtssystem, in dem international operierende Investoren Staaten verklagen können, aber nur so herum, nicht andersrum, Staaten können da keine Investoren verklagen; und die Investoren können das machen, wenn sie denken, dass ihre Eigentumsrechte in irgendeiner Art und Weise verletzt wurden. Das heißt, diese Schiedsgerichte stehen über den Staaten, aber auch über den staatlichen Rechtsinstitutionen wie Verfassungsgerichten und sind so eine Art Weltverfassungsgericht für Eigentumsrechte von Unternehmen.“
Isolda Agazzi ist Sprecherin für Investitionspolitik für Alliance Sud, ein Kompetenzzentrum für internationale Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik der Schweiz. Der Fall Glencore beschäftigt sie schon länger: „Sogar wenn diese Klage nicht durchgehen, erzeugen sie, was wir Erfrierungseffekt (chilling efect) nennen: dass die Regierungen und Staaten Angst haben. Manche Maßnahmen treffen sie nicht, weil sie Angst davor haben, dass ausländische Firmen gegen sie klagen. Fabian Flues erklärt, warum das so wirkungsvoll ist: “Das Besondere an diesem Schiedsverfahren ist, dass sich diese Urteile weltweit umsetzen lassen, wenn ein Investor ein Verfahren gewonnen hat und z.B. der kolumbianische Staat zu einer hohen Entschädigungszahlung verurteilt wurde und sich weigert zu zahlen, dann kann der Investor mit dem Schiedsspruch irgendwo anders in der Welt vor Gericht gehen und Vermögenswerte, die dem kolumbianischen Staat gehören oder zugeordnet werden können, einziehen lassen.“
Auf Mission in Kolumbien
Isolda Agazzi reiste für Alliance Sud im Mai 2023 mit einer internationalen Mission nach Kolumbien: „Es war sehr beeindruckend zu sehen, wie die indigene Gemeinschaft Wayúu in La Guajira wohnt. Zusammen mit den Afros sind sie diejenigen, die am meisten von den Aktivitäten in der Kohlemine betroffen sind, und es war beeindruckend mitzuerleben, wie sie sich dagegen wehren. Es ist so ungleichgewichtig. Es gibt diese riesige Firma, diese Multis, und dann diese Gemeinschaften, und was haben sie für Mittel? Also, nicht viel. Zum Glück werden sie von NGOs national und international unterstützt, aber es ist wirklich ein Kampf wie David gegen Goliath. Tatsächlich ist der Kampf der indigenen Gemeinden seit Jahren stark, selbstorganisiert und begleitet von sehr viel Protest. So erreichten sie auch einige Gesetzesänderungen in der kolumbianischen Verfassung.
Die kolumbianische Regierung hatte Neuverhandlung all‘ ihrer Investitionsschutzabkommen angekündigt und wollte beim Abkommen mit der Schweiz anfangen. Diese Neuverhandlungen wurden bereits aufgenommen. Die internationale Mission, mit der auch Isolda in Kolumbien war, forderte insbesondere den Ausschluss von Investorenklagen beim internationalen Schiedsgericht. Tatiana berichet: „Im Moment wird der kolumbianische Staat von Glencore verklagt, weil das Unternehmen seine Aktivitäten am Bruno-Strom nicht ausweiten durfte. Eine unserer Forderungen an Glencore ist, diese Klage zurückzuziehen, denn damit wollen sie nur die kolumbianische Regierung unter Druck setzen, keine Entscheidungen zu treffen, um die Rechte auf Wasser und die Gesundheit der betroffenen Bevölkerung zu schützen. Es ist eine Art, die Souveränität unseres Landes zu untergraben.“
Wie viel Handlungsspielraum haben die Staaten des globalen Südens eigentlich wirklich?
Unter der Regierung Petro wurden erstmals zwölf Verfassungsurteile zugunsten der lokalen Gemeinschaften erlassen, von denen jedoch keines vollumfänglich umgesetzt wurde. Zu groß ist die Angst vor astronomischen Entschädigungszahlungen, die der multinationale Konzern in einem Fall bereits gefordert hat. Wir fragen Fabian Flues, wie viel Handlungsspielraum die Staaten des globalen Südens eigentlich wirklich haben, angesichts drohender Klagen: „Was in aller Regel keinen Erfolg hat, ist, sich zum Beispiel auf seine menschenrechtlichen Verpflichtungen zu beziehen, denn die spielen in solchen Investitionsschutzverträgen keine Rolle. Ein Bezug auf die eigenen Verfassung ist häufig nicht relevant.“
Investorenklagen lähmen Fortschritte in Sachen Klimaschutzabkommen und Einhaltung von Menschenrechten zu Gunsten von Profiten. Der Ursprung dieser sogenannten bilateralen Investitionsabkommen, kurz BIT, führt uns in die Sechziger Jahre zurück. Sie sollten Investoren aus dem Norden schützen, sicherten den Fortbestand kolonialer Verhältnisse und garantierten multinationalen Konzernen ihre Profite auf Kosten des Globalen Südens.
Die Zombie-Klausel
Eine Reihe von Ländern hat sich entschieden, aus diesem System ganz auszusteigen oder zumindest erhebliche Änderungen vorzunehmen, die ihre Möglichkeiten, ihre eigenen politischen Ziele umzusetzen, besser schützt. Brasilien hat Handelsabkommen mit Investitionsschutz nie unterschrieben, und eine Reihe von lateinamerikanischen Ländern haben ihre Verträge aufgekündigt. So zum Beispiel Bolivien, Ecuador und Venezuela. Um nachhaltig die eigene Verfassung garantieren zu können, muss auch Kolumbien den Ausstieg aus diesen Verträgen schaffen. Allerdings ist der Ausstieg aus diesen Verträgen nicht immer einfach, sagt Fabian Flues: „Viele dieser Verträge haben eine antidemokratische Klausel, die nennen wir eine Zombie-Klausel. Wenn man nämlich aussteigt aus dem Vertrag, sind die Bedingungen trotzdem noch bindend und folgen dir wie ein Zombie. Viele dieser Verträge sagen, auch wenn man aussteigt, gilt der Vertrag noch für 15, manchmal sogar 20 Jahre.“
Ein Audio zum Text findet ihr hier:
![]() Paralleljustiz um Kohle von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.
Paralleljustiz um Kohle von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.
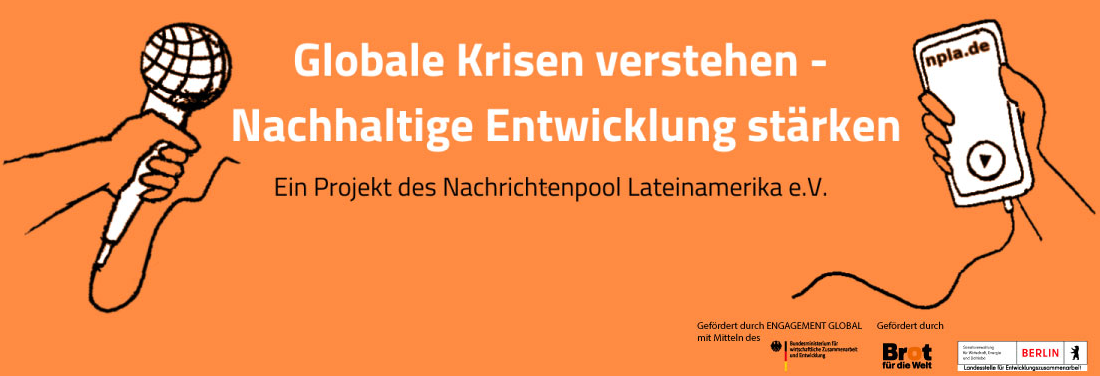
Schreibe einen Kommentar